Wo Piratenfischer ums Überleben kämpfen
SPIEGEL ONLINE - 08. Juni 2006, 17:30
(» URL)
Geisterschiffe
Von Dave Walsh und Pierre Gleizes (Fotos)
Vor der westafrikanischen Küste rotten Dutzende Trawler ihrem Ende entgegen. Wo die Schiffe ihre vermeintlich letzte Ruhe finden, leben Menschen inmitten von Verfall und Verzweiflung. Der Alltag der Piratenfischer auf den morschen Kähnen ist lebensgefährlich - und überlebenswichtig.
Am Heck des Trawlers entziffern wir seinen Namen: "Zhang Yuan Yu 15". Sonst sehen wir vor allem Rost, das Schiff fällt förmlich auseinander. Das Vorschiff gleicht einem Schrottplatz. Winschen und Motoren sind unbrauchbar, zerstört, achtern ist das Deck mit ausgefransten Kabeln vermüllt. Der Mast ist gebrochen und liegt quer auf dem Peildeck. An der Reling über der Brücke ein chinesisches Schriftzeichen, ebenfalls vergammelt, das Symbol für "Glück".
Im letzten Hafen hatten wir das Gerücht von einem Ankerplatz gehört, an dem die ausgemusterten Trawler der Piratenfischer ihre letzte Ruhe finden. 130 Kilometer vor der Küste Guineas stoßen wir tatsächlich auf diesen Schiffsfriedhof. Die Wracks liegen im flachen Wasser des afrikanischen Schelfs vor Anker, offensichtlich aufgegeben von ihren Besitzern und ihrer Crew. Schon im nächsten Sturm würden die Kähne absaufen, das scheint uns klar. Womit wir nicht gerechnet haben: Auf den Schiffen leben Menschen.
Wir gehen mit unserem Schlauchboot längsseits, und Zizi, unsere chinesische Dolmetscherin, ruft den Trawler an. Ein Mann steckt verdutzt seinen Kopf aus einer Luke. Die Stimme einer Frau, hier draußen? Der Mann bahnt sich einen Weg durch die Trümmerlandschaft an Deck, um uns zu begrüßen. Sarah, unsere Fischereiexpertin, stellt die Fragen, Zizi übersetzt. Was er hier macht? Er ist der Zweite Offizier an Bord und erst vor fünf Tagen angekommen. Jetzt wartet er auf den Rest der Crew, hat aber nicht die Spur einer Ahnung, wann sie kommen wird. Der Trawler? Liegt seit wenigstens drei Monaten genau an diesem Fleck. "Ist das Schiff denn noch einsatzbereit?", fragen wir. "Ja, klar", erwidert er und zeigt auf die marode Ausrüstung an Deck. Er scheint überrascht, dass wir fragen. Wir wundern uns, dass der Kahn überhaupt noch schwimmt.
Dass diese Expedition anders werden würde als übliche Greenpeace-Kampagnen, war uns vorher klar. Das Thema dieser Etappe unserer "SOS Weltmeer"-Fahrt war der stille, vergessene Skandal der illegalen Fischerei. Gemeinsam mit der Environmental Justice Foundation, die sich für die Gleichberechtigung beim Zugang zu natürlichen Ressourcen einsetzt, und Behörden vor Ort wollen wir Piratenfischer stellen und ihr Vorgehen dokumentieren.
"IUU" heißen ihre Fänge in der Sprache der Fachleute: illegal, unregulated, unreported - also gesetzeswidrig, ohne Quote und von keiner Statistik erfasst. Wir wissen bereits, dass dieser Fisch von Westafrikas Küste zu den Kanarischen Inseln verfrachtet und dort in den westeuropäischen Markt eingeschleust wird. Die Europäische Union - und besonders die Spanier - haben bisher stets ein Auge zugedrückt, was diese Fänge betrifft. Auch das ein Ziel unserer Expedition: die europäische Komplizenschaft in diesem Geschäft aufzudecken.
Piratenfischerei klingt harmlos, ein Kavaliersdelikt. Tatsächlich aber konkurrieren die großen ausländischen Trawler, egal ob mit Lizenz oder ohne, in den Küstengewässern mit den einheimischen Fischern, die wie immer schon von winzigen Pirogen ihre Netze auswerfen. Weil die Bestände überfischt sind, müssen die afrikanischen Fischer immer weiter auf die offene See hinausfahren; wir haben sie bis zu 100 Kilometer vor der Küste gesichtet. Von den Gefahren der See abgesehen, droht ihnen ständig die Kollision mit großen Schiffen. Auf dem Radarschirm der Trawler - sofern er funktioniert - sind die kleinen Boote kaum zu erkennen.
"Kaum Gelegenheit zum Nachdenken"
Die traditionelle Kleinfischerei ist im Niedergang. Westafrika ist die einzige Weltregion, in der der Verbrauch von Fisch zurückgeht. Wir sind auf unserer Reise einem koreanischen Trawler begegnet, einem 30 Meter langen Schiff, dessen Deck zur Behausung für 200 sengalesische Pirogenfischer umgebaut war. Der Trawler diente den Männern und ihren 40 kleinen Booten als Mutterschiff, sie waren damit bis nach Liberia gedampft, um Fisch zu finden. Die eigenen Gewässer geben längst nicht mehr genügend her.
An Bord der aktiven Trawler, der legalen wie der illegalen, sind die Lebensbedingungen kaum besser als auf den Geisterschiffen. Chinesische, koreanische und afrikanische Crews haben häufig Knebelverträge unterschrieben, die es ihnen für zwei Jahre nicht erlauben, ihren Fuß an Land zu setzen. Ihre Heuer bekommt nach Abschluss des ersten Jahres die Familie ausgezahlt, nach dem zweiten Jahr auf See folgt die nächste Rate.
Eine Woche später kehren wir zu einem zweiten Besuch auf den Friedhof der Trawler zurück. Wir treffen Jia, einen 30 Jahre alten, sehnigen Mann, er lächelt uns freundlich zu. Vor fünf Tagen hat er sich von seiner Frau und seinem elfjährigen Sohn Xinyi verabschiedet. Wenn Jia ihn das nächste Mal sieht, wird Xinyi 13 Jahre alt sein. Wie geht er damit um? Er räuspert sich verlegen und schaut auf die demolierten Maschinen an Deck. "Wenn ich erst einmal am Fischen bin, habe ich kaum Gelegenheit, darüber nachzudenken."
Nachdem er zu Hause in Dalian seine Arbeit im Kohlebergwerk verloren hatte, verdingte er sich über eine Arbeitsvermittlung bei Lian Run. Das Unternehmen hat ihn samt Familie nach Conakry in Guinea geflogen, und nun sitzt er auf der heruntergekommenen "Lian Run 16". Das Schiff liegt hier schon seit September vergangenen Jahres.
Nur noch Rost und verfaultes Holz
Seine Erwartungen? Er hatte angenommen, das Boot sei neuer. Trotzdem, um seine Sicherheit macht er sich wenig Sorgen. "Trawler halten mehr aus als andere Schiffe." Außerdem will er ja nicht ewig bleiben. Er ist Decksmatrose, 6200 Dollar im Jahr soll er verdienen.
Die Backbordseite der Brücke besteht nur noch aus Rost und verfaultem Holz, sie droht jeden Moment zusammenzubrechen. Quiang, ein cooler Typ mit Sonnenbrille und langen Haaren, versichert uns, dass die Maschine wieder läuft, nur an Rumpf und Aufbau seien "noch ein paar Reparaturen" fällig. Auf der Brücke selbst finden wir nur einen Kompass und eine Kontrolleinheit für die Maschine. Das Deck ist komplett mit Rostkrümeln eingedeckt, die unter unseren Schuhen knirschen. Aufbau und Vorschiff haben einmal aus Blechen bestanden, die mit einer dünnen Schicht Beton überzogen waren. Der Zement rieselt überall von den Wänden. Alle Winschen an Deck sind unbrauchbar, wie Stacheln stehen Fransen geborstener Stahlseile aus den rostigen Überresten. Die Bordwände sind an manchen Stellen kollabiert, die rotten Bleche hochgebogen wie geöffnete Deckel einer Sardinendose.
Eine Leine verbindet die "Lian Run 16" mit einem zweiten Geisterschiff, der "Zhang Yuan Yu 17". Ihre Maschine ist nicht mehr zu gebrauchen, und der einzige Mann an Bord hangelt sich auf einem kleinen Holzfloß von einem Schiff zum anderen. Er lebt hier bereits seit sieben Monaten, sein einziger Gefährte ist ein kleiner Affe, den er gerade mit einer Kordel in dem Verschlag angebunden hat, der einmal als Klosett diente.
Als ich vom Bug unseres Schlauchboots auf die "Zhang Yuan Yu 17" klettere, rieselt Rost in meine Sandalen. Ich trete mit meinem Fuß kräftig auf und löse eine Lawine von Rost aus. Sarah ist hinter mir, zieht sich an der Bordwand hoch und hat plötzlich ein großes Stück davon in der Hand. Mir war klar, dass diese Schiffe in einem erbärmlichen Zustand sind, aber es selbst zu fühlen und den Verfall zu riechen, ist eine andere Sache.
Kun ist 30 Jahre alt, schlank und fit, er hat dichtes schwarzes Haar und ein paar fürchterliche Narben auf den Armen. Er fischt schon seit zwei Jahren vor der Küste von Guinea und hofft, dass er jetzt bald nach Hause kann. Die Lian-Run-Flotte besteht aus 40 Schiffen, der Manager ist ein Verwandter von Kun. Auf der "Zhang Yuan Yu 17" ist er Erster Offizier. Als das Schiff hier vor Anker ging, bekam er Order zu bleiben. Er hat ein Kind, das er erst zwei Mal gesehen hat, zuletzt 2003.
Die Fänge, sagt er uns, seien zurzeit schlecht. Was mit großer Wahrscheinlichkeit an den Piratenfischern liegt - wer kann schon die Entwicklung von Beständen kontrollieren, ohne zu wissen, wie viel Fisch wirklich angelandet wird? Kun hat bislang gutes Geld verdient. Wenn es lief, 1000 Dollar im Monat. Aber ob er auch für die letzten sieben Monate Heuer bekommt? "Das Schlimmste ist die Langeweile", sagt er noch, "die Zeit vergeht so langsam hier."
Uns kam es beim Besuch der Geisterschiffe eher vor, als stehe die Uhr still oder ticke gar rückwärts. Der diesige Horizont und das spiegelglatte Wasser in der Windstille der Doldrums schaffen eine unheimliche Atmosphäre der Unendlichkeit, der Ewigkeit. Unser buntes Schiff, die "Esperanza" mit ihren roten Schlauchbooten und dem Hubschrauber, wirkt zwischen den morschen Trawlern wie Besuch aus einem anderen Jahrhundert.
Arbeitsbedingungen erinnern an Leibeigenschaft
Wir lassen den Schrottplatz der Piratenfischer hinter uns und wenden uns ihren aktiven Kollegen zu, der Wirklichkeit des industriellen Fischfangs. Wir kontrollieren ein Schiff nach dem anderen, wir fotografieren, prüfen Lizenzen und versuchen, so oft es geht, an Bord mit der Crew über die Arbeitsbedingungen zu sprechen. Auf den aktiven Trawlern wird zwar regulär Heuer gezahlt, aber auch hier leben die Fischer in Verhältnissen, die an Leibeigenschaft erinnern.
Ein paar Tage später stellen wir im Auftrag unserer offiziellen Begleiter den Trawler "Lian Run 14". Wir haben einen Leutnant der guineischen Marine und einen Mitarbeiter der Fischereibehörde an Bord der "Esperanza". Sie sollen Schiffe inspizieren, die auf hoher See ihre Fänge auf Kühlschiffe umladen (ein Vorgang, der im Jargon der Seerechtler als Transshipping bezeichnet wird), und außerdem die Lizenzen der Fischer kontrollieren. Es stellt sich heraus, dass die "Lian Run 14" keinerlei Lizenz mit sich führt und auch sonst keine Papiere an Bord hat. Alle Dokumente, behauptet der Kapitän, lägen beim Agenten, der für das Schiff zuständig ist - im Hafen von Las Palmas. Am folgenden Tag eskortiert die "Esperanza" den Trawler nach Conakry, die Hauptstadt Guineas.
Schlechte Nachrichten verbreiten sich schnell, und so machen Fischer wie Kühlschiffe in den nächsten Tagen einen großen Bogen um uns. Aber dann sehen wir nachts auf dem Radarschirm eine Kette von Leuchtpunkten, einen Konvoi von Trawlern. Wir setzen unsere schnellen Schlauchboote aus, um ihn uns aus der Nähe anzusehen - und überraschen das Kühlschiff "Elpis" dabei, wie es gerade Ladung von mehreren großen Trawlern übernimmt.
Als wir unseren Suchscheinwerfer auf die Boote richten, lösen wir dramatische Hektik aus: Lautsprecher quaken, Festmacher werden losgeschmissen, und blitzschnell löst sich der Pulk auf. Die Piratenfischer löschen alle Lampen, inklusive der Positionslichter, und dampfen mit voller Kraft in die Nacht davon. Wir versuchen noch, ihre Namen zu entziffern, doch sie sind übermalt, nicht zu erkennen.
Pete, der Kapitän der "Esperanza", notiert entsetzt ins Logbuch: "Das war von allen illegalen Aktionen der Piratenfischer ohne Zweifel die allerdümmste - nachts die Positionslichter auszuschalten. Und es ist ja nicht so, dass sie uns damit leichter austricksen können; für uns bleiben sie auf dem Radar sichtbar. Aber sie sind natürlich unsichtbar für die Besatzungen der einheimischen Pirogen, die nachts in dieser Region fischen und darauf angewiesen sind, die Positionslichter eines nahenden Schiffes rechtzeitig zu erkennen."
Seltsame Zufälle
Am 6. April beobachten wir die "Binar 4", wie sie 200 Meilen vor der Küste von kleineren Trawlern Fisch übernimmt. Die Crews sehen unseren Helikopter und werfen alle Leinen los, um sich zu verdrücken - dieselbe Prozedur wie zuvor bei der "Elpis". Wir bleiben an der "Binar 4" und rufen den Kapitän über Funk. Erst will er von Transshipping nichts wissen, dann gibt er es zu. "Aus Angst vor der guineischen Armee" habe er den Fisch außerhalb der Exklusiven Wirtschaftszone übernommen. Er sei so schnell aufgebrochen, weil er "einen Funkspruch aus Las Palmas" erhalten habe, er solle schnell in den Hafen zurückkehren. So ein Zufall.
Aber das Gesetz in Guinea ist eindeutig: Transshipping darf nur im Hafen von Conakry durchgeführt werden und nur in Anwesenheit von Fischereiinspektoren. Selbst wenn die 10.000 Kisten Fisch legal gefangen sind, wie der Kapitän angibt, hat er mit seiner Offshore-Übernahme das Gesetz gebrochen.
Wir bleiben weiter im Kielwasser der "Binar 4", bis zur Hafeneinfahrt von Las Palmas. Dann lassen wir unsere Schlauchboote zu Wasser und setzen zu dem Kühlfrachter über. Mit Spraydosen schreiben unsere Aktivisten die Anklage auf den Rumpf: "stolen fish". Sechs Tage später kommen die Regierungen von Guinea und Spanien gemeinsam zu derselben Einschätzung: Die "Binar 4" ist ein Piratenfischer. Die Ladung, 200 Tonnen Fisch, ist beschlagnahmt.
Ein kleiner Erfolg. Aber es bleibt das Gefühl, nur die Oberfläche der menschlichen Katastrophe berührt zu haben, die sich vor der Westküste Afrikas abspielt. Im Gedächtnis haftet der Geruch des Verfalls auf den Geisterschiffen. Für uns ist es der Geruch der Verzweiflung.
Zurück auf dem antriebslosen Schrotthaufen "Zhang Yuan Yu 17". In der Kabine des Ersten Offiziers Kun hängt ein Kalender, jeden Tag reißt er ein Blatt ab. Daneben zwei Fotos von ihm und seiner Frau, die er seit zwei Jahren nicht gesehen hat. Mit Filzstift hat er darunter geschrieben "Endless love".
DIE AUTOREN
Dave Walsh, 33 Jahre alt, lebt als Autor und Webdesigner in Dublin. Pierre Gleizes stammt aus dem französischen Lunay. Beide kannten die Fischerei bisher nur von Hightech- Trawlern und waren geschockt zu sehen, unter welchen Bedingungen die Piratenfischer leben. Gleizes, der Greenpeace- Kampagnen seit 1980 mit seiner Kamera begleitet, berichtet, dass er "noch nie Menschen getroffen hat, die in solcher Einsamkeit ausharren. Monatelang allein, ohne frische Lebensmittel, auf Schiffen, die weder Schwimmwesten noch Rettungsinseln an Bord haben".
Übersetzt aus dem Englischen von Olaf Kanter




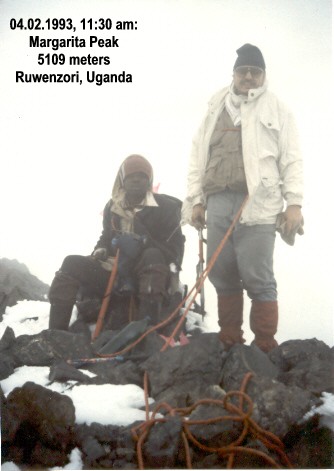
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen